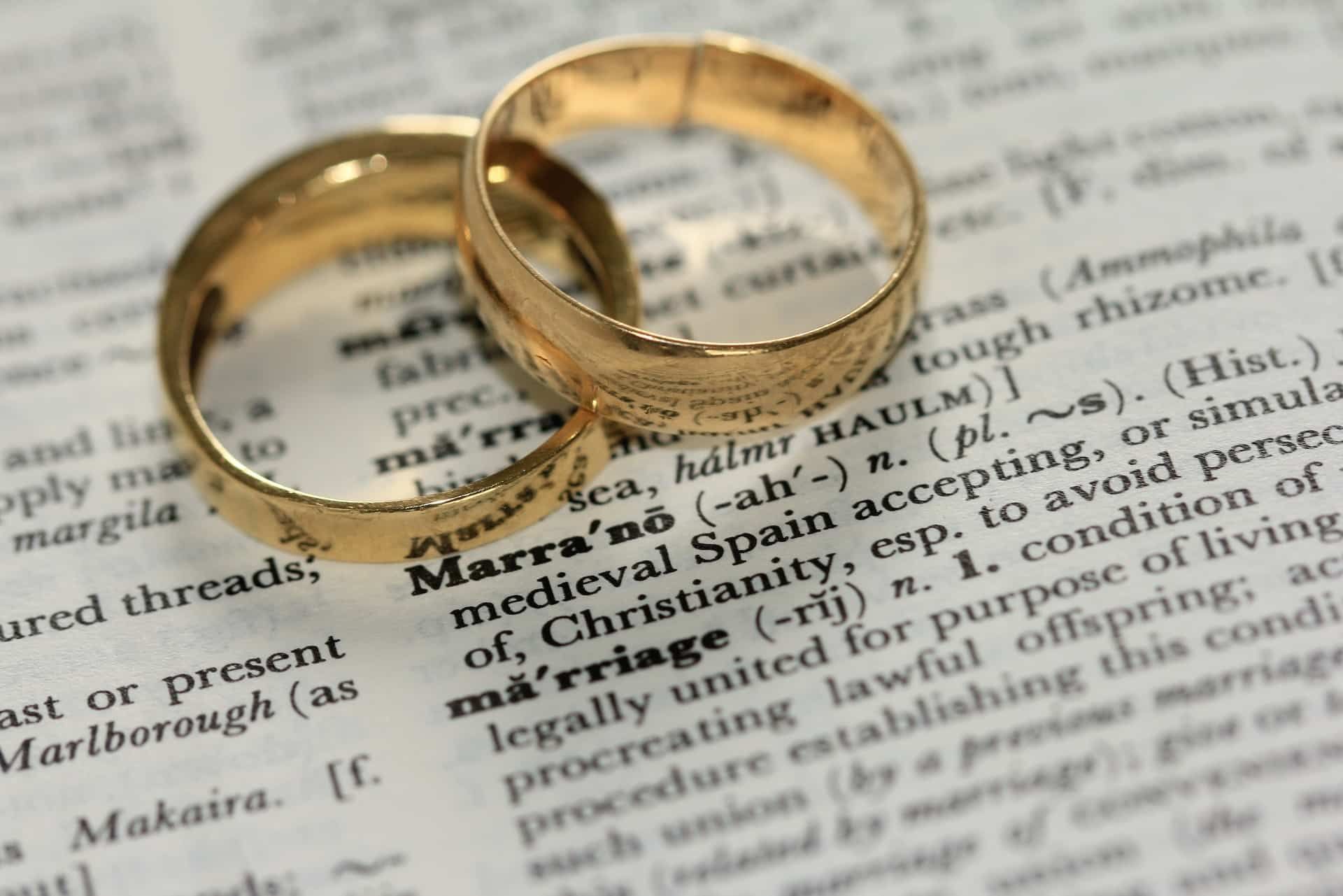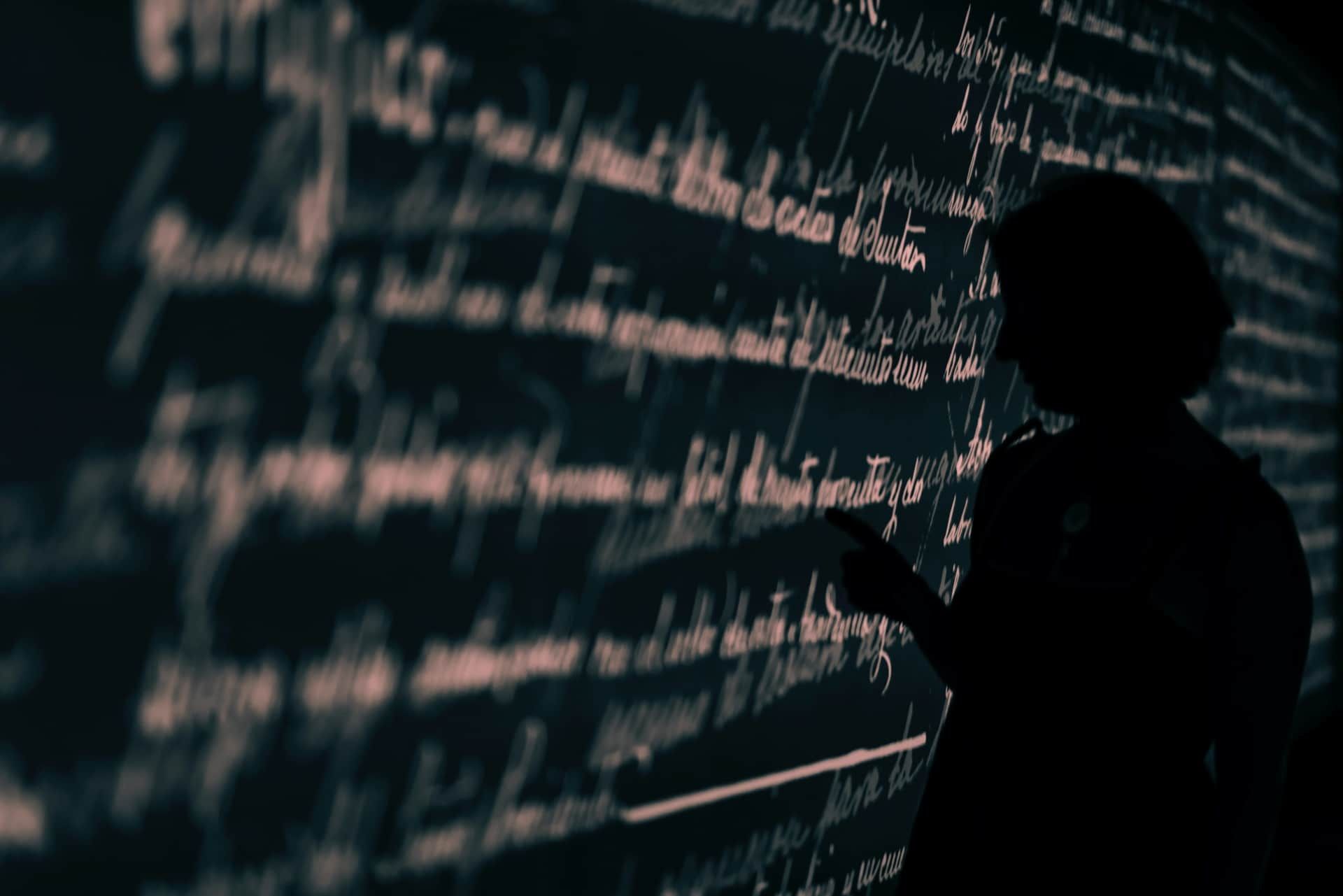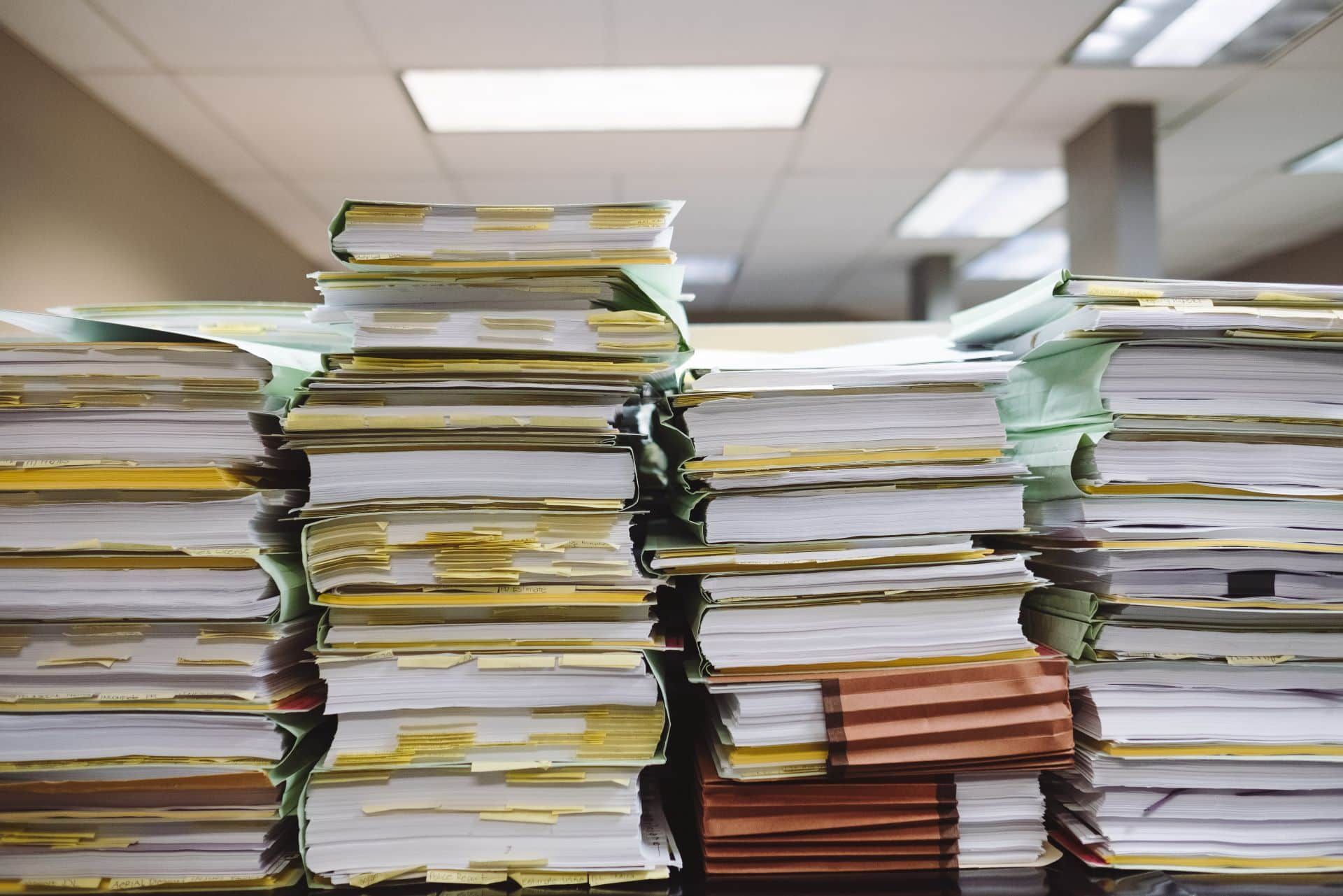Personen, die sehr gut in Österreich integriert sind, können die Österreichische Staatsbürgerschaft schon nach einem Aufenthalt von 6 Jahren erhalten. Sie müssen dafür unter anderem nachweisen, dass ihr Lebensunterhalt ausreichend gesichert ist. In diesem Artikel geht es um die Frage, wie die zuständigen Behörden diese Voraussetzung in der Praxis bewerten und wie der gesicherte Lebensunterhalt konkret berechnet wird.
Wann kann die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt werden?
1. Die Österreichische Staatsbürgerschaft kann grundsätzlich nach einem rechtmäßigen und ununterbrochenen Aufenthalt von 10 Jahren in Österreich verliehen werden, wobei der Antragsteller 5 Jahre davon in Österreich niedergelassen gewesen sein muss (zB aufgrund einer Rot-Weiß-Rot-Karte oder eines Daueraufenthaltstitels EU).
2. Unter bestimmten Umständen kann aber schon ein rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt von 6 Jahren in Österreich genügen, damit einem Nicht-Österreicher die Österreichische Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. Neben Ehegatten von Österreichischen Staatsbürgern können auch andere Personen in den Vorzug dieser verkürzten Aufenthaltsdauer kommen, wenn sie Kenntnisse der deutschen Sprache auf B2 Niveau nachweisen oder wenn sie zumindest Sprachkenntnisse auf B1 Niveau haben und ihre nachhaltige persönliche Integration in Österreich nachweisen können.
Was ist nachhaltige persönliche Integration
3. Die nachhaltige persönliche Integration kann durch ein mindestens dreijähriges, freiwilliges Engagement in einer gemeinnützigen Organisation oder durch die Ausübung eines Berufs im Bildungs-, Sozial- oder Gesundheitsbereich oder durch die Funktion in einem Interessenverband, ebenfalls jeweils für mindestens drei Jahre, nachgewiesen werden.
4. Aber auch wenn der Nachweis der persönlichen Integration gelingt, heißt das noch nicht, dass dadurch bereits die Österreichische Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. Es müssen nämlich darüber hinaus auch allgemeine Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählen Straffreiheit (für schwerwiegende Delikte), eine bejahende Einstellung zur Republik Österreich und nicht zuletzt der Nachweis eines hinreichend gesicherten Lebensunterhalts.
Wann ist der Lebensunterhalt hoch genug?
5. Die Österreichische Staatsbürgerschaft darf somit nur an Personen verliehen werden, die ihren Lebensunterhalt in Österreich durch entsprechendes Einkommen und ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen decken können und dieses ausreichend abgesichert haben.
6. Das Staatsbürgerschaftsgesetz enthält eine genaue Regelung, wie die Behörde zu berechnen hat, ob der Lebensunterhalt eines Antragstellers ausreichend gesichert ist. Dazu muss der Antragsteller feste und regelmäßige, eigene Einkünfte aus Erwerb, Einkommen, gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder Versicherungsleistungen haben. Diese Ansprüche muss der Antragsteller für einen Zeitraum von insgesamt 36 Monaten innerhalb der letzten 6 Jahre vor Antragstellung nachweisen, wobei die letzten sechs Monate vor der Antragstellung auf jeden Fall miteinbezogen werden.
7. Das bedeutet also, dass ein Antragsteller zum Nachweis seines ausreichenden Lebensunterhalts die besten 30 Monate der letzten 5,5 Jahre vor Antragstellung heraussuchen und dafür die entsprechenden Einkommensnachweise der Behörde vorlegen sollte. Außerdem sollten in den letzten sechs Monaten vor der Antragstellung ebenfalls ausreichend hohe Einkünfte vorliegen, weil diese jedenfalls in die Bewertung durch die Behörde miteinbezogen werden.
8. Wie hoch müssen die regelmäßigen Einkünfte nun aber sein, damit die Behörde diese als gesicherten Lebensunterhalt anerkennt? Die Antwort darauf findet sich im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG). Dort sind die Richtsätze für den Anspruch auf eine Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensionsversicherung geregelt. Die Einkünfte des Antragstellers müssen ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen im genannten Zeitraum (36 Monate in sechs Jahren vor der Antragstellung) zumindest dem Durchschnitt der Richtsätze der letzten drei Jahre vor der Antragstellung entsprechen. Diese Richtsätze ändern sich jährlich. 2024 beträgt der Richtsatz für Alleinstehende € 1.217,96 für Ehepaare € 1.921,46 und für jedes Kind zusätzlich € 187,93.
Nachweis des ausreichenden Lebensunterhalts
9. Zum Nachweis für den gesicherten Lebensunterhalt können Lohnzettel, Lohnbestätigungen, Dienstverträge, arbeitsrechtliche Vorverträge, Bestätigungen über Pensions- oder sonstige Versicherungsleistungen, der Nachweis über den Bezug von Kinderbetreuungsgeld oder Nachweise des eigenen Vermögens in ausreichender Höhe vorgelegt werden. Unterhaltsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn diese gesetzlich begründet sind. Leistungen aus Unterhaltsverträgen oder freiwillige Zuwendungen und Geldgeschenke (auch wenn diese regelmäßig erfolgen), können hingegen nicht für den Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts herangezogen werden.
10. Die festen und regelmäßigen eigenen Einkünfte des Antragstellers werden aber durch regelmäßige Aufwendungen verringert. Zu diesen regelmäßigen Aufwendungen zählen Miete, Kreditzahlungen, Pfändungen und Unterhaltszahlungen an Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Diese regelmäßigen Aufwendungen sind vom Nettoeinkommen abzuziehen, wobei eine sogenannte „freie Station“ bestehen bleibt (für 2024: € 359,72), die bei der Berechnung der regelmäßigen Aufwendungen nicht berücksichtigt wird. Es schmälern also nur die regelmäßigen Aufwendungen die Einkünfte, die diese „freie Station“ übersteigen. Wird in den letzten sechs Monaten vor der Antragstellung Kinderbetreuungsgeld bezogen, gilt in diesem Zeitraum der Lebensunterhalt jedenfalls als hinreichend gesichert.
Ein vereinfachtes Beispiel dazu:
Wenn ein Antragsteller (alleinstehend) regelmäßige monatliche Einkünfte von € 2.000,00 hat und regelmäßige Aufwendungen von € 800,00, ist die „freie Station“ von den regelmäßigen Aufwendungen abzuziehen (€ 800,00 – € 359,72 = € 440,28). Im Ergebnis betragen daher in diesem Monat die Einkünfte des Antragstellers € 1.559,72 und liegen damit über dem Richtsatz von € 1.217,96 für alleinstehende Personen.
12. Personen, die aufgrund einer Behinderung oder einer dauerhaften, schweren Krankheit beeinträchtigt sind, ihren regelmäßigen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, sind von der Verpflichtung diesen nach den beschriebenen Vorgaben nachzuweisen, befreit. Diese Einschränkungen müssen jedenfalls durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen werden.
Fazit
13. Die exakte Berechnung des gesicherten Lebensunterhalts als Voraussetzung für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft kann daher sehr kompliziert werden, insbesondere wenn die Einkünfte aus verschiedenen Quellen stammen oder diesen hohe regelmäßige Aufwendungen gegenüberstehen. Es empfiehlt sich daher vor der Beantragung der Verleihung der Österreichischen Staatsbürgerschaft genau zu prüfen, ob tatsächlich alle gesetzlich geforderten Voraussetzungen, so wie eben der hinreichend gesicherte Lebensunterhalt, im erforderlichen Umfang gegeben sind.